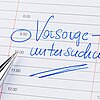Warken: "Wir brauchen mehrere Schultern, auf die wir Versorgung verteilen."
Im Interview mit dem Deutschen Ärzteblatt sprach Bundesgesundheitsministerin Nina Warken über die Arbeit im Gesundheitsministerium, geplante Änderungen bei der medizinischen Versorgung, die Apothekenreform und das Thema Frauengesundheit.
Deutsches Ärzteblatt: Das Gesundheitswesen ist extrem komplex. Nach einem halben Jahr im Amt der Gesundheitsministerin – wie empfinden Sie diese Komplexität?
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: Die Thematik der Sozialgesetzgebung kannte ich schon aus meiner Tätigkeit als Anwältin. Die Regelungen in den einzelnen Sozialgesetzbüchern sowie deren Querverbindungen sind tatsächlich sehr komplex. Und als Abgeordnete, die sich bisher vornehmlich mit anderen Themen beschäftigt hat, nimmt man viele andere Aspekte der Arbeit hier im Ministerium gar nicht so wahr: Von außen gibt es immer sehr viele Beteiligte, die sich zu Wort melden und Vorschläge machen. Mit diesen vielen Meinungen muss man als Ministerin umgehen. Bei der Einarbeitung kann ich aber auf die Expertise im Haus setzen und habe selbst viel gelesen. Wenn wir jetzt etwas Neues wie das Primärarztsystem schaffen, dann merkt man umso mehr, wie alles miteinander zusammenhängt und in welchen Bereichen wir jetzt anpacken müssen. Das macht auch Spaß. Gleichzeitig ist es auch eine Herausforderung, mit allen Beteiligten im Austausch zu bleiben. Zufrieden sind dabei nie alle, zumindest nicht gleichzeitig.
Zu Ihrer Amtseinführung hatten Sie das Bundesgesundheitsministerium als „Gesetzgebungsmaschine“ bezeichnet. Jetzt als Leiterin der „Maschine“, wie betrachten Sie das Haus?
Das Ministerium ist ein wirklich gut aufgestelltes Haus. Die Herausforderungen sind in allen Bereichen unterschiedlich, daher machen wir auch sehr viel Gesetzgebung. Auf uns warten jetzt die großen Brocken: die Apothekenreform, das Primärarztsystem und die Notfallreform. Aber auch bei den Themen Arzneimittel, Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik sind wir auf EU-Ebene sowie international gefragt. Dann spricht man wieder über Pflegegrade mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, bei der andere Herausforderungen auf der Tagesordnung stehen. Hinzu kommen viele Themen mit etwas geringerer Komplexität. Aktuell sind wir momentan jeden Monat mindestens mit einem oder mehreren Gesetzen im Kabinett. Auch für die Mitarbeitenden bedeutet das eine hohe Schlagzahl. Mein Ansatz ist, diese Belastung im Blick zu haben. Wir werden also Vorhaben clustern und nacheinander abarbeiten.
Ihre drei Amtsvorgänger hatten allerdings zum Teil zehn Gesetze gleichzeitig in den Gesetzgebungsprozessen. Das ist also nicht Ihre Strategie?
Wir haben zwangsläufig bestimmt zehn Gesetze parallel in der Bearbeitung. Ich will Dinge voranbringen. Allerdings muss man bei großen anstehenden Themen gut vorbereitet sein. Es bringt mir nichts, fünf Sachen parallel zu beginnen und dann stockt es plötzlich bei einigen Projekten. Ich starte Vorhaben erst dann, wenn ich weiß, dass das Thema wirklich vorankommt und eine gute Grundlage geschaffen ist.
Ärgert Sie es dann nicht, wenn die Grünen wie jetzt im Bundestag mit einem eigenen Gesetz zur Notfallreform vorpreschen?
Wir starten zeitnah mit der Notfallreform. Wir haben die Reform aber nicht einfach aus der Schublade ziehen können. Es ist ein Thema, bei dem man die Länder mit ins Boot nehmen muss, denn wir wollen auch von Beginn an den Rettungsdienst einbeziehen. Dort werden wir beispielsweise digitale Elemente ergänzen. Aber manchmal ist es sinnvoll, noch eine Schleife zu drehen, Gespräche zu führen und Dinge anzupassen. Insofern bin ich mit Blick auf die Opposition gelassen.
Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass das Gesetz jetzt kommt. Mein Ziel ist es, spätestens Anfang November in das Verfahren zu starten. Schwierig ist es in der Debatte aber, wenn der Eindruck erweckt wird, dass man mit der Reform unmittelbar mehrere Milliarden sparen würde. Wir sehen den Spareffekt deutlich geringer und aufwachsend. Zudem sollte man in der Dramatik der Kommunikation die Kirche im Dorf lassen. In der vergangenen Legislatur hat es mit dem Gesetz ja schließlich nicht geklappt.
Neben den digitalen Elementen: Welche weiteren Details planen Sie für das Notfallgesetz?
Wir wollen vor allem beim Rettungsdienst die Leitstellen zusammenführen und entsprechend digitalisieren. Zudem soll die Patientenkurzakte, die Notfalldaten beinhaltet, mittelfristig in die elektronische Patientenakte kommen, um in Notfällen schnell Informationen für die Versorgung zur Verfügung zu stellen. Dazu kommt die digitale Ersteinschätzung, die über beide Nummern 112 und 116 117 laufen soll, weshalb diese zusammengelegt und digital angeboten werden sollen. Später wollen wir eine Ersteinschätzung auch für das geplante Primärarztsystem implementieren.
Zusätzlich müssen wir die Abrechnung für die Fahrtkosten getrennt von den Behandlungskosten im Sozialgesetzbuch V klären sowie gleiche Qualitätskriterien schaffen. Wir wollen den Ländern und den Landkreisen nicht die Planungshoheit wegnehmen. Es soll alles einheitlicher und digitaler gestaltet werden, mit einer besseren Steuerung und das im Einklang mit den Ländern und Kommunen. Dort gibt es zwar Widerstände, aber am Ende haben wir alle das gleiche Ziel.
Die Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) wartet schon lange auf ihre Umsetzung. Wie planen Sie dieses Verfahren?
Ich sehe die Notwendigkeit der GOÄ-Reform. Es gab jahrelang keine Anpassung, daher leuchtet mir auch die Dynamisierung ein. Man hat den Beteiligten gesagt, sie sollen sich einigen. Das ist passiert, wir haben jetzt den geeinten Entwurf von Bundesärztekammer, PKV-Verband und Beihilfe. Wir gehen jetzt in die Gespräche auf Fachebene und sind dafür im Haus auch gut aufgestellt. Der Arbeitsprozess ist aufgesetzt und die GOÄ-Reform geht jetzt in die Umsetzung.
Also können Ärztinnen und Ärzte 2026 mit einer Umsetzung rechnen?
Bis zur Vorlage eines Regelungsentwurfs von uns wird es sicherlich noch bis Mitte 2026 dauern, bis zum Kabinettbeschluss wird es dann weiteren Abstimmungsbedarf geben und danach sind die Beratungen im Bundesrat abzuwarten.
Deutlich schneller ging es jetzt bei der Apothekenreform. Die Ärzteschaft hat sich über viele Details, wie das Impfen oder die Medikamentenabgabe, sehr geärgert. Wie gehen Sie auf die ärztlichen Kritiker zu?
Grundsätzlich müssen wir künftig eher von einer Primärversorgungsstruktur als von einem Primärarztsystem sprechen. Wir brauchen mehrere Schultern, auf die wir Versorgung verteilen. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, grundsätzlich die Apotheke in der Gesundheitsversorgung vor Ort zu stärken. Apotheken sollen eine Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger in Gesundheitsfragen sein, angefangen beim Impfen sowie für Beratung bei Nikotinentwöhnung oder bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher sollte das Gesetz als Chance gesehen werden. Es ist ein Angebot, dass die Selbstverwaltung Dinge gestalten kann und somit für die Bürgerinnen und Bürger neue Möglichkeiten geschaffen werden. Daher sollten sich jetzt alle konstruktiv in den Gesetzgebungsprozess einbringen, und danach den Rahmen, den wir gesetzlich vorgeben, auch mit Inhalt füllen.
Die Ärzteschaft hat besonders Sorge um die Qualität der Patientenversorgung, wie bei der Antibiotikaabgabe.
Diese Sorge nehme ich fachlich ernst, da will ich auch nichts vorschreiben. Wir setzen darauf, dass Ärztinnen und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker gemeinsam daran mitwirken, in welchen abgegrenzten Bereichen, unter welchen Voraussetzungen Arzneimittel abgegeben werden können. Der Vorschlag ist, Arzneimittel in kleinen Packungen bei einer bestehenden Dauertherapie sowie Arzneimittel bei akuten, aber unkomplizierten Erkrankungen direkt in Apotheken abzugeben. In Ländern wie Frankreich, Großbritannien und in der Schweiz liegen dazu bereits Erfahrungen vor. Dieses zusätzliche Angebot für Bürgerinnen und Bürger soll weiter gute Qualität und keine Verunsicherung bringen, sondern auch eine Entlastung für Ärztinnen und Ärzte sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) und die Kammern von Ärzten und Apothekern werden eingebunden. Die starke Selbstverwaltung ist ein Vorteil, den wir im Gesundheitswesen haben.
Sehen Sie denn die Apothekenreform auch als Vorgriff für ein Primärversorgungsmodell?
Für die künftige Primärversorgung brauchen wir mehrere Bausteine: Dazu gehören die Fortschritte in der Digitalisierung, etwa eine effektive 116 117 und eine gute laufende ePA. Bei Notfällen benötigen wir eine gute Steuerung. Wir brauchen mehrere Schultern, die mitwirken, also auch die der Apotheker. So entsteht aus einzelnen Puzzleteilen ein großes Bild.
Dabei müssen Sie viele Akteure im Gesundheitswesen und deren Wünsche miteinbeziehen. Wie wollen Sie dies angehen?
Wenn wir mit der Debatte um das Primärversorgungssystem starten, dann beziehen wir alle ärztlichen Verbände, aber auch die Krankenkassen, ein. Denn auch diese spielen eine wichtige Rolle. Derzeit wird die Diskussion in den Fachabteilungen des Hauses vorbereitet. Unser Ziel ist aber klar: Wir brauchen eine bessere Steuerung und schnellere, zielgerichtetere Termine.
Um das zu erreichen, müssen viele Dinge verändert sowie Fragen geklärt werden: Wie läuft eine Steuerung konkret ab? Wie ist es, wenn der Patient dann doch lieber direkt zum Facharzt geht? Wann muss er dafür zahlen oder gibt es einen Bonus, wenn man zuerst zum Hausarzt geht? Wie kann eine digitale Ersteinschätzung funktionieren und ist das Ergebnis für den weiteren Behandlungsverlauf dann verpflichtend? Ab welchem Punkt in der Versorgung kann ich einen Arzt sehen? Wann nicht? Neben Ärzteverbänden haben sich ja auch verschiedene Krankenkassen Modelle überlegt. Wir gehen darüber in einen offenen Dialog, werden aber am Ende als Ministerium entscheiden.
Können Sie sich im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses vorstellen, einen runden Tisch Versorgungssteuerung mit Ärzten und Kassen zu organisieren?
In den derzeitigen Einzelgesprächen mit den Akteuren gehen wir oft schon in die Tiefe der Materie. Aber wenn es demnächst um das Thema Steuerung in der Primärversorgung geht, wird die zuständige Abteilung Fachgespräche auf jeden Fall planen.
Sie kennen die hausarztzentrierte Versorgung (HzV), wie es der Hausärztinnen- und Hausärzteverband an den Start gebracht hat, aus Ihrer Heimat Baden-Württemberg. Ist das für Sie eine Blaupause für die Primärarztversorgung?
Die HzV in Baden-Württemberg ist für sich genommen ein gutes Modell. Dazu bekomme ich von den Ärztinnen und Ärzten viele positive Rückmeldungen. Aber ich verstehe auch die Krankenkassen, die andere Modelle favorisieren. Die ganze HzV auf das Kollektivsystem auszubreiten, das sehe ich nicht.
Einen detaillierten Plan haben Sie also noch nicht auf dem Tisch oder in der Schublade?
Klar ist, wir brauchen eine verpflichtende Steuerung, die nach gleichen Grundsätzen funktioniert. Ob diese ausschließlich digital ist oder man direkt zu seiner Hausarztpraxis Kontakt aufnehmen kann, darüber muss diskutiert werden. Aus meiner Sicht kann man nicht verpflichtend vorgeben, dass es ausschließlich eine Telefonnummer gibt, bei der man fünf Fragen beantwortet und am Ende des Tages landet man in der richtigen Versorgungsebene. Das muss differenzierter aufgestellt werden. Klar ist aber auch, es muss gewisse Konsequenzen haben, wenn jemand nicht an der Steuerung teilnehmen möchte. Um das umzusetzen, müssen wir beispielsweise wissen, wie gut die 116 117 digital aufgestellt ist, wer und mit welcher Qualifikation die Anrufe beantwortet und wer diese digitale Steuerung finanziert. Dazu gehört auch ein Tool, das beispielsweise zentral freie Facharzttermine vergibt. Das ist die komplexe Vorgabe und die Ausgestaltung, die wir jetzt besprechen.
Wenn Sie sagen, die 116 117 müsse gestärkt werden sowie ein Termintool für Facharzttermine müsse kommen: Gibt es angesichts der Finanzprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung für Investitionen überhaupt Spielräume?
Die Finanzsituation der GKV ist uns allen klar. Mir ist durchaus bewusst, dass mit einem neuen System, das wir etablieren wollen, auch Investitionen einhergehen. Neben den Vorschlägen zu Einsparmöglichkeiten, die wir von der Finanz-Kommission erwarten, brauchen wir dennoch gleichzeitig Ressourcen, um Strukturen auszubauen oder neue zu etablieren. Dieser Spagat mit Blick auf die Kassenlage muss uns gelingen. Wir erwarten – wenn auch nicht von Tag eins an – Spareffekte durch die Patientensteuerung, aber natürlich auch durch die Notfallreform und im weiteren Verlauf durch das Primärversorgungssystem.
Zur Finanzierung gehört auch die Möglichkeit der Eigenbeteiligungen der Patienten. Halten Sie dies für ein sinnvolles Steuerungselement?
Es ist auch ein Punkt, der in der Finanz-Kommission jetzt besprochen wird. Allein durch einen fixen Geldbetrag bekommt man keine nachhaltige Steuerung hin, das wäre der falsche Weg. Richtig wäre die Frage, wie die Eigenverantwortung bei Bürgerinnen und Bürgern gestärkt werden kann, um die Ressourcen im Gesundheitswesen zu schonen. Das System muss so einfach sein, dass die Bürger es akzeptieren.
Kommen wir zur Krankenhausreform. Sie haben kürzlich Krankenhäuser in ihrem Wahlkreis besucht: das neue Bürgerspital Wertheim sowie das Caritas Krankenhaus in Bad Mergentheim. Wie erklären Sie vor Ort, wie ihr Krankenhausanpassungsgesetz nun hilft, finanzielle und organisatorische Probleme zu lösen?
Es ist uns wichtig, nicht nur die großen Zentren wie Unikliniken als Versorger zu haben. Mit dem Krankenhausanpassungsgesetz sorgen wir auch dafür, dass die ursprünglichen Ziele der Reform erhalten bleiben, wir aber trotzdem auch in der Fläche gut aufgestellte Häuser haben – insbesondere für die Grund- und Notfallversorgung.
Vor Ort habe ich dargestellt, dass man künftig in der Region schauen muss, wie sich die kleinen Häuser aufstellen, welche Angebote künftig vorgehalten werden und wie das wirtschaftlich funktionieren kann. Dazu muss auch der Blick auf das gerichtet werden, was es in der Umgebung als Angebot schon gibt. Für diesen Planungsprozess haben wir mit dem Krankenhausanpassungsgesetz nun noch einmal mehr Zeit gegeben, beispielsweise neue Leistungsgruppen zu etablieren, und auch die nötigen Fachärzte dafür zu bekommen. Ich habe dafür geworben, dass man sich jetzt auf den Weg macht und schnell zusammen mit dem Land plant. Diese Zusammenarbeit sollte aber nun beginnen, damit die Häuser zügig sehr genau wissen, wie sich die Leistungsgruppen und die Vorhaltevergütungen auswirken. Diese Auswirkung können sie durch die gesetzlichen Anpassungen nun wirklich abschätzen.
Vor Ort weiß jeder, dass Änderungen notwendig sind. Die muss man gut begleiten. Baden-Württemberg ist ja schon sehr weit in der effizienten Krankenhausplanung, da wird es zügig mehr Klarheit für einzelne Häuser geben. Für die Veränderungen vor Ort stellen wir mit dem Transformationsfonds in den kommenden Jahren viel Geld zur Verfügung. Zudem haben die Krankenhäuser mit dem Gesetz nun mehr Planungssicherheit.
Dennoch haben wir uns natürlich gewundert, dass die Krankenhäuser bei kurzfristiger Stabilisierung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung den größten Anteil leisten mussten.
Es ist nicht so, dass die Krankenhäuser nun die GKV-Finanzen retten müssen. Wir nehmen Krankenhäusern nichts weg. Wir haben die Regelung so gestaltet, dass sie die tatsächlichen Kostensteigerungen abbildet. Bei ähnlichen Ausgabensteigerungen wie derzeit gehen wir im kommenden Jahr trotz dieser Maßnahmen von Mehrausgaben in Höhe von rund acht Milliarden Euro aus. Insgesamt werden für den Krankenhausbereich dann rund 120 Milliarden Euro von der GKV ausgegeben. Bei künftigen Sparvorschlägen in der Versorgung wird die derzeit tagende Finanz-Kommission Vorschläge machen, wie in allen Bereichen des Gesundheitswesens Einsparungen stattfinden können. Es sollte nicht vergessen werden, dass kein anderer Bereich in der Versorgung künftig so viel Steuermittel bekommt wie der stationäre.
Die Idee der Vorhaltevergütung, die bereits im vorherigen Gesetz angelegt wurde, wird weiterhin stark kritisiert. Dabei geht es vor allem um die Fallabhängigkeit und die Frage, ob Kliniken nun im Vorfeld zu viele Fälle machen. Wollen Sie das noch mal ändern?
Das Gesetz ist so in der letzten Legislatur angelegt worden. Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, dass zunächst andere Bereiche der Krankenhausreform angepasst werden sollen. Die anhaltende Kritik nehme ich aber sehr wohl wahr. Wir werden im Blick behalten, wie sich die Reform finanziell wirklich auf die Häuser auswirkt. Ob die Regelung in Zukunft für sämtliche Häuser sinnvoll ist, muss sich zeigen. Deswegen ist es aber auch gut, dass die Länder jetzt planen können. Mit der Auswirkungsanalyse wird man dann sehen, in welche Richtung es geht. Diese nun geschaffene Möglichkeit ist ein echter Vorteil.
Im Zuge der Reform hat die Ärzteschaft oft auf die Vereinbarkeit der Reform mit der ärztlichen Weiterbildung hingewiesen. Durch die Umstrukturierungen könnten Ausbildungs- und Rotationsmöglichkeiten fehlen. Wollen Sie dort noch mal nacharbeiten?
Noch kann man die Auswirkungen der Krankenhausreform nicht auf jeden einzelnen Standort beurteilen. Aber natürlich ist die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten ein wichtiger Punkt, den wir ernst nehmen. In meinem ländlichen Wahlkreis war es immer so, dass zahlreiche niedergelassene Ärzte aus den Krankenhausstandorten rekrutiert wurden. Das darf nicht komplett wegfallen. Wir müssen nun schauen, wie sich in den kommenden Jahren die Reform auswirkt, auch mit Blick auf die sektorübergreifende Versorgung.
Kommen wir noch zum Thema Forschung: Ihre Kabinettskollegin, die Ministerin Dorothee Bär, hat bei sich im Forschungsministerium ein eigenes Referat Frauengesundheit aufgelegt. Nach der Neuorganisation im Organigramm des Bundesgesundheitsministeriums ist dieses Thema nicht mehr sichtbar. Gerade als Vorsitzende der Frauen Union, die Sie sind, ist das verwunderlich.
Frauengesundheit ist für mich ein zentrales Thema, das im BMG noch stärker in den Fokus gerückt wird und auch hier bei mir in der Leitungsabteilung des Ministeriums eng begleitet wird. Während sich die Kollegin Bär um den Bereich Forschung kümmert, schauen wir insbesondere auf die Versorgung: Wir werden noch in diesem Jahr einen Dialog zum Thema Wechseljahre anstoßen. Ebenso werden wir Themen wie die Endometriose stärker in den Fokus rücken oder die Liposuktion bei Lipödem als Regelversorgung. Beide Ministerien werden auch Themen gemeinsam machen können, aber wir haben eben unterschiedliche Aufgabenstellungen in beiden Häusern. Gut ist, wenn wir bei diesem Thema breit aufgestellt sind.
Ihr Ministerium haben sie deutlich umgestellt im Vergleich zu ihren beiden Amtsvorgängern. So ist der Bereich Prävention beispielsweise nun in einer anderen Abteilung.
Wir haben das Ministerium neu aufgestellt, um deutlich schlanker und schlagkräftiger zu werden. Wir haben die Bereiche Prävention und öffentliche Gesundheit jetzt in einer Abteilung zusammengelegt, ebenso die Gesundheitsberufe. Damit haben wir Doppelstrukturen aus der Vergangenheit abgebaut. Nicht mehr jedes Thema ist im Namen des Referats enthalten. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Im Gegenteil.