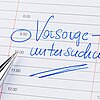Warken: „Wir müssen alle lernen, bewusster mit Ressourcen umzugehen.“
Im Interview mit der WELT am SONNTAG spricht Bundesgesundheitsministerin Nina Warken über eine zukunftsfähige Finanzierung des Gesundheitssystems. Sie geht auf das Primärversorgungssystem ein, das Hausärzte zur zentralen Anlaufstelle für Patienten macht und auf die elektronische Patientenakte, die die Versorgung effizienter gestalten soll. Sie erläutert die Krankenhausreform sowie den Einsatz von KI zur Entlastung bei Dokumentation, Pflege und Diagnostik.
Welt am Sonntag: Frau Warken, die Arbeitgebervertreter fordern mehr Eigenverantwortung der Krankenversicherten und sprechen von zu hohen Gesundheitskosten. Bedeutet das: Die Patienten müssen künftig stärker zur Kasse gebeten werden?
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: Dass unser Gesundheitssystem teuer ist, bestreitet niemand. Problematisch ist weniger die Höhe der Ausgaben als deren Steuerung. In Deutschland genießen wir ein sehr freies System – die Menschen können praktisch ohne Hürde zu jedem Arzt gehen, zu dem sie wollen. Dieses System müssen wir intelligenter steuern. Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, ein Primärversorgungssystem einzuführen. Das bedeutet: Der Hausarzt wird die erste Anlaufstelle, die Patientinnen und Patienten stärker lenkt. Das ist kein Entzug von Freiheit, sondern ein Schritt zu mehr Verantwortung. Wir müssen alle lernen, bewusster mit Ressourcen umzugehen. Ob es dafür Anreize oder moderate Gebühren braucht, um die Steuerung auch wirklich zu erreichen, wird Teil der Diskussion sein.
Die Arbeitgeber schlagen eine Kontaktgebühr vor, ähnlich der früheren Praxisgebühr. Wäre das ein Weg?
Eine pauschale Kontaktgebühr bei jedem Arztbesuch oder quartalsweise für alle halte ich nicht für sinnvoll. Das Modell von einst hat weder die gewünschte nachhaltige Steuerungswirkung erzielt noch die Bürokratie reduziert. Wenn, dann müssen wir gezielter ansetzen – etwa mit einer Gebühr, wenn jemand ohne Überweisung direkt zum Facharzt geht und sich nicht an den vorgegebenen Pfad hält. Ich habe unabhängig davon eine Kommission eingesetzt, die alle Optionen prüft – einnahmenseitig und ausgabenseitig. Wichtiger als Gebühren ist aber, dass wir Gesundheitskompetenz fördern: weniger Doppeluntersuchungen, bessere digitale Vernetzung, sinnvollere Terminsteuerung. Das ist effizienter als ein pauschaler Obolus pro Quartal.
Geben die Krankenkassen zu viel Geld aus?
Das Hauptproblem ist die Effizienz. Es gibt zu viele Arztkontakte, zu viele Schnittstellen, zu wenig Koordination. Deshalb setzen wir nicht auf immer mehr Geld, sondern auf Strukturreformen. Die elektronische Patientenakte wird helfen, Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Entscheidend ist, dass wir die Versicherten besser durch das System lotsen – und zwar ohne ihnen Leistungen pauschal zu streichen.
Worauf müssen sich die Bürger einstellen?
Unser klares Ziel ist es, die Beiträge zu stabilisieren – auch um den Faktor Arbeit nicht immer weiter zu verteuern. Das ist sozial- und wirtschaftspolitisch richtig. Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, aber wir müssen die Mittel effizienter einsetzen. Wenn künftig weniger Menschen direkt zum Facharzt gehen können, ist das keine Kürzung, sondern eine klügere Steuerung. Gleichzeitig müssen wir den teuren stationären Bereich entlasten – durch mehr ambulante Behandlung und weniger Bürokratie.
Ist die einkommensabhängige Finanzierung der Krankenversicherung noch zukunftsfähig?
Ich halte sie für das beste Modell. Es ist solidarisch und sichert den Zugang zu hochwertiger Versorgung für alle. Grundsätzlich gilt: Dieses solidarische System ist ein Wert an sich. Es garantiert Versorgungssicherheit und Innovation – und das müssen wir erhalten.
Sollte der Staat die Krankenversicherungsbeiträge für Bürgergeldempfänger vollständig übernehmen?
Die aktuelle Finanzierung deckt die Kosten nicht. Es gibt eine erhebliche Deckungslücke, die von allen anderen Versicherten getragen wird. Das ist auf Dauer ungerecht. Deshalb wäre der gesetzlichen Krankenversicherung sehr geholfen, wenn der Staat für Bürgergeldbeziehende höhere Beiträge zahlt. Wir müssen uns auch mit der Frage der Dynamisierung des Steuerzuschuss des Bundes zum Gesundheitsfonds beschäftigen – er stagniert seit Jahren. Das muss man ehrlich ansprechen und innerhalb der Regierung besprechen.
Die Krankenhausreform ist eines der umstrittensten Vorhaben dieser Legislaturperiode. Viele Länder blockieren, weil sie keine Schließungen wollen, obwohl viele Krankenhäuser wirtschaftlich am Limit stehen. Wie können Sie sinnvolle Klinikschließungen vorantreiben?
Die Krankenhausplanung liegt in der Verantwortung der Länder, aber wir schaffen mit der Reform einen verbindlichen Rahmen: Leistungsgruppen, Qualitätskriterien, Spezialisierung. Das wird zwangsläufig zu einer Bündelung führen, die wir auch brauchen. Manche Kliniken werden fusionieren, andere schließen. Das ist schmerzhaft, aber notwendig, um Qualität und Wirtschaftlichkeit zu sichern und die Ressourcen effizient einzusetzen. Unser Ziel ist eine wohnortnahe Grundversorgung und gleichzeitig spezialisierte Zentren mit hoher Expertise. Ergänzend schaffen wir mit der sektorübergreifenden Versorgung neue Modelle, wo Krankenhäuser mit breitem stationären Leistungsspektrum nicht mehr sinnvoll sind, aber eine medizinische Basisversorgung gebraucht wird.
Welche Instrumente stehen Ihnen zur Verfügung, um Kliniken wirtschaftlicher zu machen?
Mit den neuen Vorhaltevergütungen schaffen wir Planungssicherheit. Außerdem wollen wir Bürokratie abbauen und die Personalschlüssel realistischer gestalten. Qualität ja – aber sie darf nicht in Überregulierung ersticken. Die Krankenhausgesellschaft und die Ärzteschaft haben dazu gute Vorschläge, die wir ernsthaft prüfen und gemeinsam besprechen wollen.
Können Digitalisierung und KI die Versorgung tatsächlich effizienter machen – oder ist das Wunschdenken?
Künstliche Intelligenz und Robotik können im Alltag spürbar entlasten – bei der Dokumentation, in der Pflege, in der Diagnostik. Ich habe bei verschiedenen Terminen gesehen, wie KI bei Tumorerkennung oder Darmspiegelungen unterstützt. Auch Spracherkennung für Pflegekräfte oder intelligente Logistiksysteme in Kliniken sparen Zeit. Aber: Der Einsatz dieser Technologien kostet zunächst Geld. Langfristig bin ich überzeugt, dass sie Qualität und Arbeitsbedingungen verbessern. Einsparungen werden nachziehen, aber sie sind kein Selbstzweck.
In der Pandemie wurde beschlossen, die Pharmaindustrie wieder stärker nach Europa zu holen. Seither ist wenig geschehen. Warum?
Da haben wir in der Tat Nachholbedarf. Wir wollen Produktion, Forschung und Innovation in Europa halten oder gar zurückholen. Das ist eine Frage der Versorgungssicherheit, aber auch der Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb arbeiten wir im Kanzleramt und im Gesundheitsministerium am Pharma- und Medizintechnikdialog.
Die Branche steht unter Druck – auch durch US-Politik wie das „Most-Favored-Nations“-Prinzip, das Preise drückt und Investitionen bremst. Wenn wir nicht gegensteuern, droht uns der Verlust innovativer Arzneimittel. Europa muss souveräner werden. Der „Critical Medicines Act“ der EU ist ein wichtiger Schritt dahin – mit Anreizen und Vorgaben im Vergabeverfahren, die europäische Produktion von Arzneimitteln und Wirkstoffen zu stärken. Nur so bleiben wir ein verlässlicher und starker Gesundheitsstandort.
Wie kann das konkret aussehen?
Wir müssen Regulierungen prüfen, die Standorte unattraktiv machen. Ein Beispiel ist Beispiel ist die kommunale Abwasserrichtlinie, die Pharmaunternehmen insbesondere von patentfreien Arzneimitteln überproportional belastet. In Deutschland geht es um verlässliche und zügige Marktzugänge für Innovationen: Heute bekommen neue Arzneimittel im ersten halben Jahr nach Markteinführung eine sehr attraktive Vergütung, weil Unternehmen den Preis frei festsetzen dürfen. Danach wird es für Unternehmen schwieriger, , weil sie ihren Preis mit dem Spitzenverband der Krankenkassen verhandeln. . Wir müssen Wege finden, dass die Unternehmen attraktive Preise erzielen und zugleich die gesetzliche Krankenversicherung finanzierbar bleibt. Das ist ein echter Spagat.
Wer wird dann dafür zahlen, die Produktion wieder nach Europa zu holen? Der Steuerzahler oder der Beitragszahler?
Heute wird vieles über die GKV und die PKV abgebildet. Aber es geht auch um Resilienz, Versorgungssicherheit, Innovationskraft und Arbeitsplätze. Wenn wir dieses größere Bild sehen, darf man die Verantwortung nicht allein den Beitragszahlern aufbürden. Das heißt nicht, dass ich sofort nach Steuermitteln rufe. Aber wir müssen prüfen, wo gesamtstaatliche Interessen und Verantwortung berührt sind und wie wir das fair verteilen.
Während wir reden, fehlen in Apotheken und Kliniken immer wieder Medikamente Kinderhustensaft bis Schmerzmittel. Ist das jemals vollständig in den Griff zu bekommen?
Lieferengpass heißt nicht automatisch Versorgungsengpass, Apotheken dürfen zum Beispiel substituieren. Und wir tun einiges: Wir haben die Preise für Kinderarzneimittel und bestimmte Antibiotika angehoben, damit Deutschland als Markt wieder attraktiv ist. Es gibt Vorratspflichten, wir haben Rabattverträge angepasst. Aber Wirkstoffproduktion ist in Asien günstiger und dieses Rad können wir nicht komplett zurückdrehen. Wir können aber Anfälligkeiten reduzieren – mit Bevorratung, europäischer Produktion wo sie notwendig und sinnvoll ist sowie mit agiler Regulierung. Gerade bei den Kinderarzneimitteln hat sich die Versorgung inzwischen deutlich verbessert.
Kommen wir zur Versorgung vor Ort. Sie versprechen eine Termingarantie beim Facharzt, gleichzeitig fehlen Hausärzte und Fachangestellte. Wie soll das passen?
In der Tat, Hausärzte dürfen nicht zum Flaschenhals werden. Darum verteilen wir die Steuerung der Patienten auf mehrere Schultern: strukturierte Ersteinschätzung – auch auf digitalem Wege – etwa über die Servicenummer 116117, Entlastung von Bürokratie, stärkere Einbindung von Medizinischen Fachangestellten und Pflegepersonal mit erweiterten Kompetenzen. Apotheken sollen mehr impfen und bei der Prävention mitwirken. Und wir schaffen mit Advanced Practice Nurses, die künftig Pflegewissenschaften studiert haben, eine neue Berufsgruppe, die Aufgaben übernehmen soll, die bisher Ärzten vorbehalten waren.
Wie kann es für junge Ärztinnen und Ärzte wieder attraktiv werden, sich niederzulassen?
Wir brauchen weniger Bürokratie, verlässliche Rahmenbedingungen und andere Formen der Praxisorganisation. Viele junge Medizinerinnen und Mediziner schrecken die Verwaltungslast, die Personalverantwortung und auch die Notdienste ab. Wenn wir die Praxisorganisation erleichtern, Zentren mit Ärzten unterschiedlicher Fachrichtung fördern und die Familienfreundlichkeit verbessern, macht das die eigene Praxis attraktiver. Geld allein ist nicht das Problem, die Work-Life-Balance ist entscheidend, vor allem für Frauen.
Und der große Personalmangel im Gesundheitswesen insgesamt lösen wir den durch Ausbildung, Zuwanderung oder beides?
Beides. Wir werben gezielt um Nachwuchs und haben Ausbildungswege entwirrt. Bis jetzt gab es 27 unterschiedliche Landesregelungen bei der Ausbildung zur Pflegefachassistenz, die haben wir vereinheitlicht und Aufstiegspfade definiert. Gleichzeitig setzen wir auf faire Migrationspartnerschaften. Dazu sind wir zum Beispiel mit Indonesien im Gespräch, wo mehr medizinisches Personal ausgebildet als vor Ort gebraucht wird. Wir beschleunigen die Anerkennung ausländischer Qualifikationen für Heilberufe und Apotheker. Außerdem erweitern wir Kompetenzen, denn die Pflege kann oft mehr als sie bisher darf, etwa in der Wundversorgung oder im Diabetesmanagement. Das macht Pflegeberufe attraktiver und entlastet Ärztinnen und Ärzte.
In Ihrer Partei wird derweil über die Rückführung syrischer Geflüchteter gestritten. In Deutschland arbeiten Tausende syrische Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte. Gefährden Rückführungen die Versorgung?
Man muss sauber trennen: Rückführungen, die nötig sind, freiwillige Rückkehrund Fälle, in denen Menschen hier arbeiten, integriert sind und die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht erfüllen. Es wird Menschen geben, die bleiben können, solche, die zurückgehen wollen, und solche, die zurückgeführt werden müssen. Das sind unterschiedliche Sachverhalte, die einzeln geprüft werden. Die Versorgungssicherheit hängt nicht an der Entscheidung jedes Einzelfalls, sondern an stabilen Strukturen. Klar ist aber: Für die medizinische Versorgung werden wir weiterhin auf qualifizierte Zuwanderung setzen müssen.
Elektronische Gesundheitskarte, E-Rezepte, elektronische Patientenakte; was hierzulande unter großen Protesten eingeführt wird, gibt es in anderen EU-Ländern oft schon zehn Jahre früher. Warum hinkt Deutschland so oft hinterher?
Wir zielen zu oft auf die Lösung mit Goldrand und starten zu spät. Datenschutz und -sicherheit sind zentral, aber sie lähmen zu häufig Innovation. Grundsätzlich brauchen wir mehr Mut, Anwendungen früher auszurollen, Feedback aufzunehmen und zügig nachzuschärfen. Das neue Digitalministerium hilft, dabei Tempo zu machen und das im Oktober gestartete Forschungsdatenzentrum, das erstmals Gesundheitsdaten zentral, sicher und datenschutzkonform für Forschung und Versorgung nutzbar macht, zeigt, wie sichere Datennutzung möglich ist.
Braucht es in der Gesundheitspolitik mehr Mut und weniger Angst vor Kritik?
Entscheidungen unter Kritik auszuhalten, gehört dazu. Was nicht geht, ist vor lauter Angst nichts entscheiden. Dann bleiben Patientinnen und Patienten auf der Strecke.
Wie sehr bremsen Lobbyistinnen und Lobbyisten aus Ärzteschaft, Kliniken, Medizintechnik dabei aus?
Sie bremsen nicht. Interessenvertretung ist in einem freiheitlichen System legitim, gerade in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens. Viele Hinweise sind hilfreich, weil sie Praxiserfahrungen spiegeln. Wichtig ist, fair und offen zu bleiben und am Ende zu entscheiden, auch wenn nicht alle zufrieden sind. Politik darf sich nicht in Dauerschleifen verheddern.