Fragen und Antworten - Samenspenderregistergesetz
Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen ist am 1. Juli 2018 in Kraft getreten.

© Copyright: AdobeStock/spotmatikphoto

© Copyright: Himmelssturm – stock.adobe.com

© Copyright: AdobeStock/wavebreak3

© Copyright: RUNSTUDIO / Getty Images

© Copyright: Adobe Stock / Zerbor

© Copyright: BMG/Thomas Köhler (Photothek)

© Copyright: gettyimages.de/Patrick Foto

© Copyright: Adobe Stock / oatawa

© Copyright: Adobe Stock / Andrea Gaitanides

© Copyright: BMG/Thomas Koehler/Bundesgesundheitsministerium

© Copyright: Adobe Stock / HNFOTO

© Copyright: VisualField/iStockphoto

© Copyright: yuki33/shutterstock

© Copyright: Adobe Stock / Jintana

© Copyright: Adobe Stock / Andy Dean

© Copyright: Getty Images

© Copyright: AdobeStock/ipopba

© Copyright: Andrey Popov / Adobe Stock

© Copyright: Adobe Stock / REDPIXEL
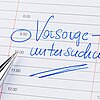
© Copyright: Adobe Stock / Gina Sanders

© Copyright: Shutterstock/Rawpixel.com

© Copyright: BMG/Giesen; Schinkel

© Copyright: getty images / aelitta

© Copyright: Bundestag/Achim Melde

© Copyright: BMG/Jan Pauls

© Copyright: BMG/Jan Pauls

© Copyright: BMG/Jan Pauls

© Copyright: Jan Pauls

© Copyright: BMG

© Copyright: David Peters

© Copyright: BMG/Giesen; Schinkel

© Copyright: gguy/AdobeStock

© Copyright: Christian Schwier/AdobeStock

© Copyright: iStock/BrianAJackson

© Copyright: Getty Images/Westend61

© Copyright: Getty Images / May Lim / 500px
Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen ist am 1. Juli 2018 in Kraft getreten.
Jeder Mensch hat das Recht zu erfahren, von wem er abstammt. Ziel des Gesetzes ist es daher, Personen, die durch eine Samenspende im Rahmen einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung gezeugt worden sind, zu ermöglichen, durch Nachfrage bei einer zentralen Stelle ihr Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung verwirklichen zu können.
Mit dem Gesetz werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines bundesweiten zentralen Samenspenderregisters geschaffen, das nunmehr beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geführt wird. Darüber hinaus wird durch eine ergänzende Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch die gerichtliche Feststellung der rechtlichen Vaterschaft des Samenspenders in diesen Fällen ausgeschlossen. Damit wird der Samenspender insbesondere von Ansprüchen im Bereich des Sorge-, Unterhalts- und Erbrechts freigestellt.
Im Samenspenderregister werden die im Gesetz genannten personenbezogenen Daten des Samenspenders und der Empfängerin der Samenspende gespeichert. Zudem werden darüber hinausgehende freiwillig vom Samenspender gemachte Angaben zu seiner Person, z.B. zu seinem Aussehen oder seiner Schulbildung, und den Beweggründen für seine Samenspende gespeichert. Auch gespeichert werden das Geburtsdatum des Kindes/der Kinder oder der errechnete Geburtstermin sowie die Anzahl der Kinder.
Umfassende Regelungen wie die Zweckbindung der Verwendung der personenbezogenen Daten und die klar geregelten Übermittlungswege gewährleisten einen hohen Datenschutzstandard.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes kann jede Person, die vermutet, mittels einer Samenspende gezeugt worden zu sein, auf Antrag Auskunft aus dem Samenspenderregister über die dort gespeicherten Daten des Samenspenders erhalten. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres kann eine Person ihren Auskunftsanspruch nur selbst geltend machen. Vor Erreichung des 16. Lebensjahres kann die Auskunft durch die gesetzlichen Vertreter beantragt werden. Diesen steht aber kein eigenes Recht auf Kenntnis der zum Samenspender gespeicherten Angaben zu.
Die Auskunft begehrende Person kann ihre Anfrage an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte richten. Dabei sind eine Kopie des Personalausweises und die Geburtsurkunde vorzulegen.
Vor der Erteilung einer Auskunft aus dem Samenspenderregister empfiehlt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einer auskunftsbegehrenden Person die Inanspruchnahme einer spezifischen Beratung und weist auf bestehende Beratungsangebote hin.
Der Anspruch richtet sich auf Mitteilung der im Samenspenderregister enthaltenen personenbezogenen Daten und freiwillig gemachte Angaben des Samenspenders.
Das Gesetz enthält spezifische Melde- und Dokumentationspflichten, die sich an Samenbanken, Einrichtungen der medizinischen Versorgung und das Samenspenderregister richten. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Samenspenderregister alle erforderlichen Daten gespeichert sind, um eine fehlerfreie Identifizierung des Samenspenders zu ermöglichen. Beim ersten Auskunftsantrag führt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Melderegisterabfrage durch, um die aktuelle Anschrift des Samenspenders in Erfahrung zu bringen. Bei späteren erneuten Auskunftsersuchen besteht diese Verpflichtung nicht mehr.
Sowohl der Samenspender als auch die Empfängerin der Samenspende werden vorab umfassend über die Erfassung und Speicherung ihrer personenbezogenen Daten bei der Entnahmeeinrichtung oder der Einrichtung der medizinischen Versorgung sowie beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgeklärt. Da die gesetzlich vorgeschriebene Aufklärung auch rechtliche Aspekte umfasst, kann die Entnahmeeinrichtung beziehungsweise die Einrichtung der medizinischen Versorgung die Aufklärung von dem Samenspender und von der Empfängerin der Samenspende auch zum Beispiel auf Rechtsanwälte oder Notare delegieren.
Es ist eine Aufbewahrungsdauer von 110 Jahren festgelegt, die sich an der maximalen Lebenserwartung orientiert. Die Dauer der Datenspeicherung entspricht der Dauer bei Adoptionen im Hinblick auf das Geburtenregister und die Sammelakten. Die Frist beginnt mit Eingang der Daten des Samenspenders beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer oder wenn die erfolgreiche künstliche Befruchtung nicht zur Geburt eines Kindes geführt hat, sind die Daten zu löschen.
Eine nachträgliche Erfassung personenbezogener Daten stößt auf Grund von Einwilligungs- und Widerrufserfordernissen auf nicht zu überwindende Hindernisse. Im Übrigen ist eine rückwirkende Anwendung des Gesetzes weder im Hinblick auf die gesetzliche Grundlage für die Speicherung der personenbezogenen Daten noch im Hinblick auf den Ausschluss der rechtlichen Vaterschaft des Samenspenders zulässig.
Auskunft über die Abstammung durch eine Anfrage beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte können nur die Personen erlangen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes durch heterologe Verwendung von Samen gezeugt worden sind. Zu Gunsten der vor Inkrafttreten des Gesetzes mittels heterologer Verwendung von Samen gezeugten Personen ist die im Transplantationsgesetz für Samenbanken festgelegte Aufbewahrungsfrist von personenbezogenen Daten des Samenspenders von 30 Jahren auf insgesamt 110 Jahre verlängert. Damit kann die betroffene Person auch langfristig bei der Samenbank Auskunft über den Samenspender erlangen.
Für solche Fälle sieht das Gesetz Übergangsregelungen vor. Diese sollen verhindern, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits vorhandener Samen vernichtet werden müssen. Soll ein solcher Samen heterolog bei einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung verwendet werden, müssen nachträglich die im Gesetz festgelegten Anforderungen erfüllt werden.
Kann der Samenspender nicht mehr ausfindig gemacht werden oder widerspricht er einer Verwendung, darf der Samen nicht mehr verwendet werden.
Ein Bezug von Spendersamen aus dem Ausland ist bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Außerdem muss die Einrichtung der medizinischen Versorgung sicherstellen, dass die ausländische Samenbank der Aufforderung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Übermittlung der personenbezogenen Daten des Spenders nachkommen wird. Dies kann durch eine entsprechende vertragliche Vereinbarung erfolgen.
Das Gesetz sieht auch für die Fälle, in denen eine Samenspende vor Inkrafttreten des Gesetzes im Rahmen einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung heterolog verwendet worden ist, Übergangsregelungen vor. So hat die Einrichtung der medizinischen Versorgung die zur Verwirklichung des Auskunftsanspruchs erforderlichen und vorhandenen Angaben 110 Jahre lang aufzubewahren. Die verlängerten Aufbewahrungsfristen gelten somit für die Einrichtungen der medizinischen Versorgung sowohl bei der Übertragung von kryokonservierten imprägnierten Eizellen als auch bei der Übertragung von Embryonen auf die Frau, von der die Eizelle stammt. Eine Verpflichtung zur Meldung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte besteht nicht. Etwaige Auskünfte können von dort daher auch nicht erteilt werden. Die im Gesetz festgelegte Freistellung des Samenspenders von der Inanspruchnahme als rechtlicher Vater gilt in diesen Fällen ebenfalls nicht.
Stand: 7. Dezember 2020