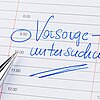Fragen und Antworten zur Reform der Notfallversorgung
Was ändert sich bei den Notrufnummern?
Durch die Notfallreform wird die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117 für Hilfe in akuten Fällen ausgebaut.
Die bisherigen Aufgaben der Terminservicestelle im Bereich der Akutfallvermittlung nimmt zukünftig die sogenannte Akutleitstelle der Kassenärztlichen Vereinigung wahr. Deren digitale Vernetzung mit
en Rettungsleitstellen ermöglicht eine bessere Steuerung und Übergabe von Hilfesuchenden.
Die bedarfsgerechte Steuerung entlastet sowohl Notaufnahmen als auch Rettungsdienste. Über die Notrufnummer 112 ist für Notfälle mit Lebensgefahr oder schweren gesundheitlichen Störungen eine Rettungsleitstelle immer direkt erreichbar, hier ändert sich nichts.
Zur Förderung des Ausbaus der Strukturen der 116117 stellen die gesetzliche Krankenversicherung und die Kassenärztlichen Vereinigungen zusätzliche Mittel paritätisch durch eine pauschale Vorhalte finanzierung bereit.
Was ist ein Gesundheitsleitsystem?
Ein Gesundheitsleitsystem besteht aus einer Rettungsleitstelle mit der Notrufnummer 112 und einer Akutleistelle mit der Rufnummer 116117, die digital miteinander vernetzt sind. Es gibt zwischen den Partnern eines Gesundheitsleitsystems eine verbindliche Absprache, welche Fälle von welchem Partner übernommen werden; die Ersteinschätzungssysteme sind entsprechend aufeinander abgestimmt.
Zusätzlich gibt es eine direkte digitale Verbindung, über die Anrufende sowie ihre bereits aufgenommenen Daten ohne Medienbruch an die andere Leitstelle übermittelt werden können, wenn der Fall von dieser bearbeitet wird. Hilfesuchende bekommen so gesichert den richtigen Ansprechpartner vermittelt. Für die Leitstellen funktionieren die Abläufe reibungsloser und es wird Zeit gespart.
Was passiert, wenn ich 116117 anrufe?
Unter der 116117 können mittels eines Ersteinschätzungsverfahrens die Beschwerden der Anrufenden bewertet und den Hilfesuchenden die erforderliche Versorgung vermittelt werden. Viele akute Beschwerden können schnell und unkompliziert mittels telefonischer ärztlicher Beratung eingeschätzt und geklärt werden, auch mit Video. Dies entlastet Notaufnahmen, aber insbesondere die Hilfesuchenden selbst. Diese müssen nicht mehr in eine Notdienstpraxis fahren. Diese Option wird gesetzlich bundesweit einheitlich vorgegeben.
Macht der Notdienst der KV auch weiter Hausbesuche?
Ja, auch dies wird gesetzlich vorgegeben. Zukünftig wird dies auch rund um die Uhr angeboten. Dies entlastet volle Praxen, Ärztinnen und Ärzte müssen diese nicht mehr für einen Hausbesuch verlassen. Der Hausbesuchsdienst ist aber nur für Menschen da, die ihn wirklich benötigen und nicht in ein INZ kommen können.
Wie werden Notaufnahmen entlastet?
Durch die Notfallreform werden an ausgewählten Krankenhäusern Integrierte Notfallzentren (INZ) flächendeckend etabliert. Sie bestehen aus Notaufnahme des zugelassenen Krankenhauses, Notdienstpraxis und Ersteinschätzungsstelle. Diese werden untereinander digital vernetzt.
Wesentliches Element des Integrierten Notfallzentrums ist die zentrale Ersteinschätzungsstelle, die Hilfesuchende der richtigen Struktur innerhalb des Integrierten Notfallzentrums zuweist. Perspektivisch soll dies über eine standardisierte, qualifizierte und digitale Ersteinschätzung geschehen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten von Notdienstpraxen mit Arzneimitteln direkt vor Ort ohne weitere Wege soll durch die Einführung von Versorgungsverträgen mit öffentlichen Apotheken verbessert werden.
Zudem können Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche (KINZ) aufgebaut werden.
An Standorten, an denen die Einrichtung von Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche etwa aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist, wird eine telemedizinische Unterstützung von Integrierten Notfallzentren durch Fachärztinnen und -ärzte für Kinder- und Jugendmedizin gewährleistet.
Und was ist an Wochenenden, wenn die Notaufnahmen besonders überlastet sind?
INZ sind grundsätzlich 24 Stunden am Tag geöffnet. Um einer Überlastung vorzubeugen, unterstützt die KV in gesetzlich festgelegten Zeiten (Wochenende 9-21 Uhr, Mittwoch und Freitag 14-21 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag 18-21 Uhr) mit der Notdienstpraxis. Auf der Grundlage einer standardisierten, qualifizierten Ersteinschätzung werden die Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht in die Notaufnahme oder in die Notdienstpraxis des INZ weitergeleitet.
Verkürzungen der Öffnungszeiten der Notdienstpraxis sind im Rahmen der Kooperationsvereinbarung möglich, wenn empirisch nachgewiesen wird, dass eine Öffnung auf Grund geringer Inanspruchnahme unwirtschaftlich ist.
Die ambulante Akutversorgung außerhalb dieser Zeiten können auch Kooperationspraxen nahe dem INZ übernehmen. Dies sind zur Patientenversorgung geeignete, im Umkreis des jeweiligen Krankenhausstandortes gelegene zugelassene Ärzte sowie medizinische Versorgungszentren, die organisatorisch und technisch so mit dem Integrierten Notfallzentrum vernetzt sind, dass eine zeitlich nahtlose, rückverfolgbare und digitale Fallübergabe zwischen dem Integrierten Notfallzentrum und der Kooperationspraxis möglich ist. Ist keine dieser Praxen geöffnet, übernimmt die Krankenhausnotaufnahme die ambulante Versorgung.
Kann man auch gleich in ein INZ gehen?
Mit Akutfällen kann man immer ein INZ aufsuchen, sollte aber möglichst vorher die Rufnummer 116117 wählen – das spart oft den Weg ins INZ.
Patientinnen und Patienten, die zuvor die 116117 angerufen haben und einen entsprechenden Nachweis erhalten haben, werden bei gleichgewichtigen Beschwerden in der Regel schneller behandelt als Selbsteinweiser mit entsprechender oder geringer Behandlungsdringlichkeit.
Das INZ ersetzt nicht den Hausarzt – hier darf nur die zwingend notwendige Erstversorgung erfolgen.
Was ändert sich beim Rettungsdienst für die Bürgerinnen und Bürger?
Im Ablauf ändert sich nichts. Nach Anruf beim Notruf 112 wird auf Grundlage einer standardisierten Abfrage durch die Leitstelle entschieden, welches Rettungsmittel entsandt werden muss – Rettungswagen, Notarzt, Hubschrauber. oder ob eine Weiterleitung an die Akutleitstelle der 116117 angemessen ist.
Wenn sich vor Ort herausstellt, dass ein Transport in ein Krankenhaus nicht erforderlich ist, kann eine Versorgung vor Ort erfolgen, darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Menschen z.B. in eine Arztpraxis zu fahren.
Die Notfallrettung wird aber Teil der Sachleistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Bisher gab es nur eine Erstattung der Kosten. Dies bedeutet, dass bei einem Streit zwischen Rettungsdiensten und Krankenkassen die Gefahr bestand, dass Notfallpatientinnen und Notfallpatienten auf den Kosten sitzen bleiben könnten. Dies wird damit ausgeschlossen.
Im Hintergrund kümmert sich ein bundeseinheitliches Gremium um Qualität und bundesweit einheitliche Standards.
Maßnahmen beim plötzlichen Herzkreislauf-Stillstand
Es wird gesetzlich vorgegeben, dass in allen Rettungsleitstellen am Telefon bereits zur Reanimation angeleitet wird. Ebenso werden die Rettungsleistellen bundesweit mit Ersthelfer-Apps vernetzt. Damit werden freiwillige Ersthelfer in der Nachbarschaft bei einem Kreislaufstillstand sofort alarmiert und führen schnell erste Maßnahmen durch. Um für die Leitstellen und die Ersthelfer die im öffentlichen Raum zugänglichen Defibrillatoren zu finden, werden diese in einem bundesweit einheitlichen Kataster registriert.
Wird die Zuständigkeit für den Rettungsdienst den Ländern genommen?
Nein, die verfassungsmäßigen Zuständigkeiten der Länder werden nicht eingeschränkt.
Bislang hat die gesetzliche Krankenversicherung die medizinische Notfallrettung indirekt als Fahrkostenersatz finanziert. Künftig wird sie als Sachleistung der GKV verankert. Das medizinische Notfallmanagement, die Versorgung vor Ort und die Betreuung während des Transports werden so als Teile der Krankenbehandlung anerkannt. Wesentlich ist hierfür die Konkretisierung des Leistungsanspruchs im Fünften Buch Sozialgesetzbuch.
Die Länder bleiben für die regionale Planung und Organisation zuständig, während Krankenkassen Verträge mit den geplanten Leistungserbringern schließen.
Die Kombination aus Planungsverantwortung der Länder und vertraglicher Finanzierungsbasis der Krankenkassen schafft Rechts- und Finanzklarheit für alle Beteiligten.
Welche Rolle spielt die ePA?
Die Digitalisierung und die digitale Vernetzung zwischen Leistungserbringern der medizinischen Notfallrettung und den anderen Akteuren der Notfall- und Akutversorgung ist ein zentraler Baustein der
Notfallreform.
Die medizinische Notfallrettung wird technisch so angebunden, dass eine digitale, fallbezogene Übergabe an nachfolgende Leistungserbringer möglich ist. Dazu gehören die standardisierte Übermittlung relevanter Falldaten, die Übertragung in die Klinik sowie Schnittstellen zur ambulanten Akutversorgung.
Ein System zur Anzeige der aktuellen Verfügbarkeit von Krankenhausressourcen wird verbindlich, sodass die Entscheidungsfindung für Zielkliniken verbessert wird.
Was sind die Änderungen im Vergleich zum Entwurf der letzten Legislaturperiode?
- Für die Errichtung von INZ schließen die KBV, die DKG und der GKV-SV auf Bundesebene Rahmenvereinbarungen über die Grundsätze der Zusammenarbeit. So werden bundesweit einheitliche Vorgaben für INZ-Strukturen geschaffen und gleichzeitig der bürokratische Aufwand der Kooperationspartner vor Ort, die zukünftig nur Konkretisierungen festlegen müssen, verringert. Bei lokalen Besonderheiten kann von den Rahmenvereinbarungen auch abgewichen werden.
- Um Ressourcen zu schonen, können die Kooperationspartner in INZ von der Einrichtung einer Notdienstpraxis absehen, wenn die ambulante Versorgung im gleichen Umfang und Qualität durch ein MVZ oder eine Vertragsarztpraxis in unmittelbarer Nähe der Notaufnahme abgedeckt wird.
- Die Ersteinschätzung des medizinischen Behandlungsbedarfes von Hilfesuchenden muss in allen Notaufnahmen von Krankenhäusern, auch in solchen ohne INZ, stattfinden. Dadurch können Versicherte von einem Krankenhaus ohne INZ an eines mit INZ gesteuert werden.
- Die Strukturen der ambulanten Akutversorgung bei einem Anruf der Akutleitstelle der 116117 werden konkretisiert. Der aufsuchende Dienst der KV soll erst dann vermittelt werden, wenn weder eine Vermittlung in die Regelversorgung, eine telemedizinische Behandlung noch eine Versorgung in einem INZ im Einzelfall möglich und geeignet sind.
- Die Vergütung von Leistungen der medizinischen Notfallrettung wird im Rahmen von Entgeltverträgen zwischen Leistungserbringer und Krankenkassen festgelegt. Die Kostenübernahme von Fahrkosten oder von einseitig festgelegten hoheitlichen Gebühren ist intransparent und bildet das Leistungsgeschehen nicht mehr ab. Vertragsbeziehungen sind ein wesentliches Element des Sachleistungsprinzips in der gesetzlichen Krankenversicherung und schaffen Rechtssicherheit sowohl für die Leistungserbringer als auch für die Patientinnen und Patienten, die nicht mehr befürchten müssen, Kosten selbst tragen zu müssen.
- Die Vernetzung von Rettungsleitstellen und Notaufnahmen bzw. die Steuerung von Patientinnen und Patienten in das „richtige“ Krankenhaus wird verbessert. Hierfür wird die Nutzung eines digitalen Informationssystems, das insbesondere die Kapazitäten der ansteuerbaren Krankenhäuser darstellt, für Leistungserbringer der Notfallrettung verpflichtend.
- Aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität erfolgt eine Anschubfinanzierung (225 Mio. Euro) für Investitionen in die digitale Infrastruktur der Leistungserbringer der Notfallrettung. Dadurch werden nicht nur die Finanzen der GKV entlastet, sondern es wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Infrastruktur nicht nur gesetzlich Versicherten zur Verfügung steht.
- Der „Qualitätsausschuss Notfallrettung“ wird durch ein beim GKV-SV angesiedeltes Gremium ersetzt, das Rahmenempfehlungen zur medizinischen Notfallrettung beschließt. In diesem Gremium kann jedes Land einen stimmberechtigten Vertreter entsenden – auch Leistungserbringe und Verbände sind eingebunden.