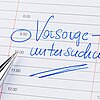Für Schutzimpfungen gelten die allgemeinen Grundsätze des Rechts der Versorgung von Impfschäden und der Sozialen Entschädigung. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde das Recht der Versorgung von Impfschäden in das Vierzehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XIV) überführt. Nach § 24 Satz 1 SGB XIV muss für einen Impfschaden eine gesundheitliche Schädigung vorliegen, die über das übliche Ausmaß einer Reaktion auf eine Schutzimpfung hinausgeht.
Für Impfschäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind, die seit dem 1. Januar 2024 vorgenommen wurden, besteht insbesondere ein Anspruch auf Leistungen der Sozialen Entschädigung, wenn die Schutzimpfung von der zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich vorgenommen (§ 24 Satz 1 Nummer 1 SGB XIV) oder von Gesundheitsämter unentgeltlich durchgeführt wurde (§ 24 Satz 1 Nummer 3 SGB XIV).
Der Anspruch auf Versorgung setzt weder Rechtswidrigkeit noch Verschulden voraus, sondern beruht maßgeblich auf der Kausalität zwischen der Impfung und deren Folgen. Dabei gelten Beweiserleichterungen für den Nachweis der Kausalität zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge der über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung. Zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Schädigung genügt die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen des Anspruchs im Einzelfall vorliegen, sind medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse heranzuziehen. Für die übrigen Voraussetzungen des Anspruchs muss der Vollbeweis erbracht werden, das heißt, dass deren Vorliegen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen sein muss.
Dabei ist die sog. „Kann-Versorgung“ als weitere Beweiserleichterung zu beachten. Wenn die Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht, kann mit Zustimmung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde der Gesundheitsschaden trotzdem als Folge einer Impfschädigung anerkannt werden. Die Zustimmung kann auch allgemein erteilt werden. Voraussetzung ist der Rechtsprechung zufolge, dass nach mindestens einer medizinischen Lehrmeinung der Ursachenzusammenhang zwischen schädigendem Ereignis und Gesundheitsstörung nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist.
Die Entscheidung über Anträge auf Versorgungsleistungen obliegt den jeweils zuständigen Landesbehörden. Die Anerkennung eines Impfschadens erfolgt auf Antrag, der bei der zuständigen Behörde zu stellen ist. Das ist in der Regel das Versorgungsamt. Wenn die Schutzimpfung im Inland durchgeführt wurde, richtet sich der Anspruch gegen das Bundesland, in dem der Impfschaden verursacht wurde.
Nach § 141 Satz 1 SGB XIV erhalten auch Personen, die vor dem 1. Januar 2024 geschädigt worden sind, Leistungen nach dem SGB XIV, wenn die Voraussetzungen nach § 60 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung (a.F.) erfüllt waren. Im IfSG war bis zum 31. Dezember 2023 insbesondere geregelt, dass für Impfschäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind, die von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich vorgenommen wurde, ein Anspruch auf Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) besteht (§ 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 IfSG a.F.)