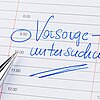Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen
Gesundheit im Alter ist für jede Einzelne und jeden Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft von großer Bedeutung. Obwohl im Alter gesundheitliche Probleme und Beschwerden zunehmen, ist das Alter nicht gleichbedeutend mit Krankheit, Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit. Individueller Lebensstil, persönliche Ressourcen, die soziale Integration und die medizinische Betreuung beeinflussen den Gesundheitszustand, die Lebensqualität und das Wohlbefinden.
Allgemeines/Demografische Entwicklung
Zwei Trends werden die Bevölkerung Deutschlands verändern. Erstens lautet die erfreuliche Nachricht hinter dem oftmals problematisch beschriebenen demografischen Wandel: Die Menschen gewinnen Lebenszeit. Zwischen 1991/93 und 2022/2024 ist die Lebenserwartung bei Geburt für Männer um knapp sechs Jahre (auf 78,5 Jahre) und für Frauen um etwa vier Jahre (auf 83,2 Jahre) gestiegen. Zweitens ist die Geburtenrate insbesondere Mitte der 1960er Jahre bis Mitte der 1970er Jahre steil abgefallen. Zwischen 2011 und 2016 konnte zwar ein leichter Anstieg beobachtet werden, doch zuletzt ist die Geburtenrate wieder gesunken. Die Bevölkerung würde ohne Nettozuwanderung seit Langem schrumpfen, da seit dem Jahr 1972 die Zahl der Gestorbenen die Zahl der Geborenen jedes Jahr übersteigt.
Die Bevölkerung wird durch die oben beschriebenen Veränderungen im Schnitt älter: Im Jahr 2024 lag das Durchschnittsalter in Deutschland bei 44,9 Jahren und könnte laut der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes auf bis zu 50 Jahre im Jahr 2070 ansteigen. Der 15. Bevölkerungsvorausberechnung (Bezugsjahr 2021) zufolge wird die Zahl älterer Personen (67 Jahre und älter) von derzeit 16,4 Millionen bis Ende der 2030er-Jahre um weitere 4 bis 5 Millionen auf mindestens 20,4 Millionen steigen. Damit wird es auch mehr Pflegebedürftige geben. Ihre Zahl wird von rund 5,7 Millionen Ende 2023 auf voraussichtlich etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen, und bis zum Jahr 2070 auf 6,9 Millionen (ein stärkerer Anstieg wird nicht erwartet, da die geburtenstarken Jahrgänge dann durch geburtenschwächere Jahrgänge im höheren Alter abgelöst werden).
Weitere Informationen finden Sie auf
Vorbeugung von Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit
Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation
Mit steigendem Alter treten vermehrt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Adipositas, Muskel- und Skeletterkrankungen, Atemwegserkrankungen, Krebs und Demenzen auf. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen gewinnen an Bedeutung.
Chronische Erkrankungen und das gleichzeitige Auftreten mehrerer Erkrankungen nehmen zu, was häufig mit einer eingeschränkten Lebensqualität, hohen Behandlungskosten und einem erhöhten Risiko für Pflegebedürftigkeit verbunden ist. Konkret bedeutet es, dass in der Altersgruppe der 70- bis 74-Jährigen 10,2 Prozent der Männer und 11,1 Prozent der Frauen, in der Altersgruppe der 80- bis 84-Jährigen bereits 28,2 Prozent der Männer und 39,1 Prozent der Frauen und bei den über 90-Jährigen 75,3 Prozent der Männer und 91,4 Prozent der Frauen pflegebedürftig sind.
Ein gesundheitsfördernder Lebensstil – mit Bewegung, ausgewogener Ernährung, geistiger Aktivität, sozialer Teilhabe und Verzicht auf Rauchen sowie Alkoholmissbrauch – kann viele chronische Erkrankungen verhindern oder positiv beeinflussen. Prävention und Gesundheitsförderung bleiben bis ins hohe Alter wichtig und wirksam, auch bei Pflegebedürftigkeit.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf dem Internetportal "Gesund und aktiv älter werden" des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit.
Das Präventionsgesetz, das am 25. Juli 2015 in Kraft getreten ist, sieht daher auch Präventionsmaßnahmen für pflegebedürftige Menschen vor. Die Pflegekassen haben den Auftrag erhalten, Leistungen zur Gesundheitsförderung in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen zu erbringen. Der GKV-Spitzenverband hat dazu den Leitfaden „Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 5 SGB XI“ veröffentlicht, der auf Grundlage einer umfassenden Evaluation der präventiven Leistungen der Pflegekassen nach § 5 SGB XI im September 2023 neu gefasst wurde. Dieser Leitfaden legt die Kriterien für die Leistungen der Pflegekassen zur Prävention und Gesundheitsförderung in stationären Pflegeeinrichtungen fest.
Um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, sind alle geeigneten Leistungen zur Prävention wie auch zur medizinischen und gegebenenfalls zur geriatrischen Rehabilitation frühzeitig einzuleiten. Nach den Regelungen des am 29. Oktober 2020 in Kraft getretenen Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetzes (IPReG) wird von der Krankenkasse bei einer vertragsärztlich verordneten geriatrischen Rehabilitation nicht mehr überprüft, ob diese medizinisch erforderlich ist, sofern die geriatrische Indikation durch dafür geeignete Abschätzungsinstrumente vertragsärztlich überprüft wurde. Die Krankenkassen sind dann an diese Feststellung gebunden.
Pflegebegutachtung
Im Rahmen der Pflegebegutachtung geben die Gutachterinnen und Gutachter daher auch Empfehlungen zu präventiven und rehabilitativen Maßnahmen. In der Begutachtung erfolgt seit dem 1. Januar 2017 mehr als die Einstufung in einen der fünf Pflegegrade. Im Mittelpunkt steht die individuelle Situation der pflegebedürftigen Person. Wie kommt sie in ihrem Alltag zurecht? Welche Fähigkeiten sind noch vorhanden? Gibt es Hilfsmittel, die ihr das Leben erleichtern können? Kann das Wohnumfeld verbessert werden? Es wird auch geprüft, ob und in welchem Umfang Maßnahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit einschließlich der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation geeignet, notwendig und zumutbar sind. Zudem ist eine Aussage darüber zu treffen, ob Beratungsbedarf insbesondere in der häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der die anspruchsberechtigte Person lebt, hinsichtlich Leistungen zur Prävention geboten sind. Dies wird in einer gesonderten Präventions- und Rehabilitationsempfehlung festgehalten. Die Rehabilitationsempfehlung enthält auch eine „Zuweisungsempfehlung“: Soll eine indikationsspezifische oder eine geriatrische Rehabilitation empfohlen werden? Sollte die Maßnahme als stationäre, als ambulante oder als mobile Rehabilitation durchgeführt werden? Sofern die antragstellende Person eingewilligt hat, wird die Rehabilitationsempfehlung an den zuständigen Rehabilitationsträger weitergeleitet und löst dort unmittelbar ein entsprechendes Antragsverfahren aus.
Früherkennungsuntersuchungen
Darüber hinaus haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Früherkennung von bestimmten Krankheiten:
- Seit April 2019 können Frauen und Männer bereits im Alter von 18 bis 34 Jahren einmalig und Frauen und Männer ab 35 Jahren nunmehr alle drei Jahre eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung, den sogenannten Check-up in Anspruch nehmen. Der Check-up wird zumeist in hausärztlich tätigen Praxen durchgeführt. Er dient der Erfassung von gesundheitlichen Risiken und Belastungen und auch der Früherkennung von häufig auftretenden Krankheiten, vor allem von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen. Bereits seit Anfang 2017 können im Rahmen der Check-up-Untersuchung bei Bedarf auch Präventionskurse, z. B. zur Bewegung, Ernährung oder Stressbewältigung, in einer ärztlichen Bescheinigung empfohlen werden.
- Außerdem können Männer ab dem Alter von 65 Jahren seit Januar 2018 einmalig eine Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung eines Bauchaortenaneurysmas (Erweiterung der Bauchschlagader) in Anspruch nehmen. Die Untersuchung wird nur Männern angeboten, weil diese wesentlich häufiger von einem Bauchaortenaneurysma betroffen sind als Frauen. Zudem haben Männer im Unterschied zu Frauen nachweislich einen Nutzen von der Ultraschall-Früherkennungsuntersuchung.
- Als Bestandteil des „Check-ups“ haben Versicherte ab 35 Jahren seit 2021 auch die Möglichkeit, sich einmalig auf die Viruserkrankungen Hepatitis B und Hepatitis C testen zu lassen.
- Ferner haben gesetzlich versicherte Frauen und Männer einen Anspruch auf regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung von bestimmten Krebserkrankungen (Brust-, Gebärmutterhals-, Prostata-, Darm- und Hautkrebs).
Weiterführende Informationen zu den Früherkennungsuntersuchungen der gesetzlichen Krankenversicherung finden Sie z. B. unter:
Programm „Gesund und aktiv älter werden“
Gesund und aktiv älter zu werden, ist ein Ziel vieler Menschen. Dabei stehen oft Erkrankungen älterer Menschen im Fokus – und nicht die individuellen Ressourcen und Möglichkeiten vor Ort die Gesundheit zu erhalten. Eine gezielte Gesundheitsförderung kann das Älterwerden konstruktiv begleiten, indem Gesundheit, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden. Lebensqualität und Wohlbefinden hängen dabei wesentlich von gelungenen Übergängen in die Nacherwerbsphase, sozialen Kontakten, Engagement sowie den lokalen Lebensbedingungen ab.
Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) stärkt mit seinem Programm „Gesund und aktiv älter werden“ die Gesundheitskompetenz älterer Menschen. Dies geschieht durch wissenschaftlich fundierte Informationen, kostenlose Materialien, Konferenzen und Kooperationen mit Verbänden, Hochschulen und Vereinen. Schwerpunkte liegen auf Mobilität, Teilhabe und Bewegung.
Das Programm trägt auch im Sinne des Präventionsgesetzes zur Bewegungsförderung älterer Menschen bei. Es wurden u. a. zwei gesundheitsförderliche und präventive Bewegungsprogramme entwickelt:
- AlltagsTrainingsProgramm (ATP): Für Personen ab 60, die ihren Alltag aktiver gestalten möchten.
- Lübecker Modell Bewegungswelten (LMB): Für ältere Menschen mit Pflegebedarf in ambulanten und stationären Einrichtungen.
Beide Programme richten sich an die Lebenswelt der Teilnehmenden und fördern Bewegung sowie Prävention.
Nationale und internationale Akteure und Initiativen
Weitere Informationen
-
Broschüren für Menschen in der zweiten Lebenshälfte
Broschüren des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit in der Mediathek kostenfrei bestellen und heruntergeladen
-
Publikationen für Fachkräfte
Publikationen für Fachkräfte zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen