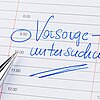Bundestag verabschiedet Gesetz für weitere Befugnisse für Pflegekräfte und Entbürokratisierung in der Pflege
Der Bundestag hat am 6. November 2025 das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege in 2./3. Lesung verabschiedet. Damit werden die Pflege umfassend entbürokratisiert und die Kompetenzen von Pflegefachpersonen erweitert.
Pflegekräfte können viel mehr als sie bislang dürfen! Zurecht erheben sie die Forderung nach mehr Befugnissen entsprechend ihrer tatsächlichen Kompetenzen. Die Versorgung muss auf mehr Schultern verteilt werden – dabei leisten Pflegekräfte einen unersetzlichen Beitrag. Wir wollen mehr Menschen für diese Aufgaben begeistern und alle stärken, die sich für diesen Beruf entschieden haben. Mehr Befugnisse erhöhen die Attraktivität, weniger Bürokratie schafft mehr Freiräume: Denn jede Minute, die sich eine Pflegekraft nicht mit Bürokratie beschäftigt, ist eine gewonnene Minute für die Versorgung am Menschen.
Die wichtigsten Regelungen des Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege
- Pflegefachkräfte werden zur eigenverantwortlichen Heilkundeausübung befugt und dürfen im Rahmen ihrer Kompetenzen in einem bestimmten Rahmen nach einer ärztlichen Erst-Diagnose Leistungen erbringen, die bisher Ärzten vorbehalten waren.
- Darüber hinaus erhalten Pflegefachpersonen die Möglichkeit, bestimmte Leistungen der ärztlichen Behandlung auch ohne eine ärztliche Diagnose zu erbringen, wenn sie den pflegerischen Bedarf im Rahmen einer pflegerischen Diagnose festgestellt haben. Die Selbstverwaltung legt unter Beteiligung der Pflegeberufsverbände dabei fest, welche Leistungen dies konkret betrifft, wobei auch abweichende Vorgaben für einzelne Versorgungsbereiche getroffen werden können.
- Ferner sollen Leistungen durch Pflegefachpersonen, die bislang Ärzten vorbehalten waren, schneller in die Fläche kommen. Im parlamentarischen Verfahren wurden daher die Fristen verkürzt, innerhalb derer die Selbstverwaltung bestimmen muss, welche ärztlichen Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen übertragen werden.
- Die Festlegungen der Selbstverwaltung sind nur der erste Schritt. Zur weitergehenden fachlichen Klärung wird wissenschaftlich eine Aufgabenbeschreibung für die berufliche Pflege erarbeitet („Scope of Practice“). Flankierend wird die Vertretung der Pflegeberufe auf Bundesebene einheitlich geregelt und damit gestärkt.
- Pflegebedürftige, die in häuslicher Pflege versorgt werden, erhalten einen leichteren Zugang zu Präventionsleistungen, etwa durch eine zielgenaue Präventionsberatung oder Präventionsempfehlung, die künftig auch unmittelbar durch Pflegefachpersonen ausgesprochen werden kann.
- Um die pflegerische Versorgung in innovativen gemeinschaftlichen Wohnformen zu fördern, werden neue Regelungen in das Vertragsrecht, das Leistungsrecht sowie in das Qualitätssicherungsrecht der Pflegeversicherung aufgenommen. Diese bieten sowohl Trägern von bereits praktizierten vergleichbaren Versorgungskonzepten als auch anderen Versorgungsformen ergänzende Optionen im bestehenden ambulanten System zur Versorgung der Pflegebedürftigen. Daneben können stationäre Leistungserbringer im Rahmen von Modellvorhaben eine Flexibilisierung ihrer Leistungserbringung im geschützten Rahmen erproben.
- Im Hinblick auf die kommunale Pflegeplanung soll die Zusammenarbeit zwischen Pflegekassen und Kommunen weiter verbessert werden. Die Kommunen erhalten künftig aktuellere Datengrundlagen und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung der pflegerischen Versorgung vor Ort. Der Ausbau der Förderung regionaler Netzwerke in der Pflege wird unterstützt.
Darüber hinaus sind umfangreiche Maßnahmen zum Bürokratieabbau in der Pflege vorgesehen
- Der Umfang der Pflegedokumentation wird gesetzlich auf das notwendige Maß begrenzt. Dieses Prinzip wird zusätzlich für den Bereich der Qualitätsprüfung ausdrücklich gesetzlich verankert.
- Um Qualitätsprüfungen störungsfrei durchzuführen und gleichzeitig die pflegerische Versorgung gut zu gewährleisten, werden die Prüfungen durch die Medizinischen Dienste (MD) künftig frühzeitiger angekündigt. Zudem sollen Heimaufsicht und MD bei Prüfungen noch besser zusammenarbeiten. Doppelprüfungen sollen so weit wie möglich verhindert und Prüfungen zusammengeführt werden.
- Wie für die vollstationäre Pflege bereits eingeführt, soll künftig auch für ambulante Pflegedienste und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, die eine Qualitätsprüfung mit dem Ergebnis eines hohen Qualitätsniveaus bestehen, der Zeitraum bis zur nächsten Prüfung von ein auf zwei Jahre verlängert werden.
- Anträge und Formulare für Pflegeleistungen sollen vereinfacht werden. Hierzu wird beim Spitzenverband der Pflegekassen ein Kooperationsgremium eingerichtet.
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5, die ausschließlich Pflegegeld beziehen, müssen die Beratung in der eigenen Häuslichkeit künftig nur noch halbjährlich einmal abrufen, statt zuvor vierteljährlich einmal. Sie erhalten jedoch weiterhin die Möglichkeit, bei Bedarf die Beratung vierteljährlich einmal in Anspruch zu nehmen. Die Beratungsbesuche werden damit verstärkt an den individuellen Bedarf der pflegebedürftigen Person angepasst.
- Um digitale Pflegeanwendungen (DiPA) schneller in die Versorgung zu bringen, wird das Antrags- und Prüfverfahren vereinfacht.
- Regelungen im Pflegevergütungsrecht ermöglichen den Vereinbarungspartnern schlankere Verfahren und zügigere Abschlüsse und tragen damit zu einer zeitnahen Finanzierung der Aufwendungen bei den Pflegeeinrichtungen bei. Zudem werden die Melde- und Umsetzungsfristen bei den Regelungen zur tariflichen Entlohnung mit längeren Fristen versehen und das Meldeverfahren für tarifgebundene Pflegeeinrichtungen vereinfacht, um diese zu entlasten. Bei Verhandlungen der Rahmenverträge durch die Pflegeselbstverwaltung ist künftig immer auch zu prüfen, wie Versorgungsprozesse effizienter werden, indem sie beschleunigt, digitalisiert oder automatisiert werden. Zudem sollen Doppelstrukturen vermieden werden.
- Beschleunigt werden sollen zudem die Verfahren bei eilbedürftigen Pflegeanträgen in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen oder Hospizen.
Ebenfalls im Gesetz
- Die Zahl der Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil wird für das Jahr 2026 weiterhin auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 Tage festgeschrieben.
- Im Rahmen der Verhinderungspflege müssen künftig Ersatzpflege-Kosten, die wegen eines vorübergehenden Ausfalls der üblichen Pflegeperson entstanden sind, bis zum Ablauf des Kalenderjahres, das auf die Durchführung der notwendigen Ersatzpflege folgt, beantragt werden. Dies soll eine zeitnahe Abwicklung der Anträge gewährleisten und Missbrauch entgegenwirken.
- Vergütungsanstiege in Krankenhäusern werden auf die reale Kostenentwicklung begrenzt. Hierzu wird für das kommende Jahr die sogenannte Meistbegünstigungsklausel ausgesetzt, wonach zwischen dem vom statistischen Bundesamt ermittelten Orientierungswert (also der tatsächlichen Kostenentwicklung im Krankenhaus ) und der Grundlohnrate (der Veränderung der durchschnittlichen Beitragseinnahmen je GKV-Mitglied) der jeweils höchste Wert als Obergrenze für die jährliche Vereinbarung des Veränderungswerts gilt. Der maximale Anstieg der Vergütungen wird damit auf die im Orientierungswert real abgebildete Kostensteigerung im Krankenhausbereich begrenzt. Damit werden Kostensteigerungen für die GKV in Höhe von bis zu 1,8 Milliarden Euro vermieden.
- Im Vergleich zum Jahr 2024 wird der Ausgabenanstieg der sächlichen Verwaltungskosten der Krankenkassen im Jahr 2026 auf acht Prozent begrenzt. Bezogen auf das Jahr 2025 bedeutet dies, dass die Zuwächse bei den Sachkosten der Krankenkassen in 2026 nur in Höhe der Inflationsentwicklung von rund 2 Prozent anfallen dürfen. Zu den Sachkosten zählen zum Beispiel Kosten für Mobiliar, Post- und Fernmeldegebühren, Aufklärungs- und Werbemaßnahmen sowie Vergütungen für externe Dritte. Durch die Begrenzung sparen Krankenkassen insgesamt einen Betrag von rund 100 Millionen Euro ein.
- Im kommenden Jahr wird die Fördersumme des Innovationsfonds einmalig von 200 Millionen auf 100 Millionen Euro gesenkt. Die gesetzlichen Krankenkassen werden im Jahr 2026 von ihrer Verpflichtung zur Finanzierung des Innovationsfonds befreit. Die Finanzierung der Fördermittel im Jahr 2026 erfolgt – mit Ausnahme des ebenfalls halbierten Finanzierungsanteils der landwirtschaftlichen Krankenkasse - ausschließlich durch die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds.
- Zudem umfasst der Gesetzentwurf auch verschiedene Regelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese zielen unter anderem darauf ab, den vertragsärztlichen Notdienst zu stärken und die digitale Transformation des Gesundheitswesens und der Pflege weiter voranzubringen.
Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.
Weitere Informationen
-
Chronik des Gesetzes
Alle Stationen und Entwürfe sowie Stellungnahmen zum Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege stehen in diesem Verzeichnis zum Download bereit.